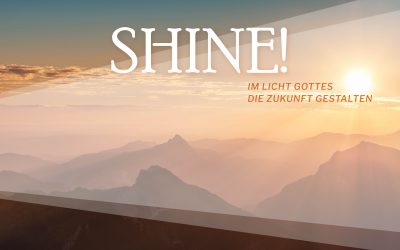Medien // Heiliger Geist // Frucht und Gaben des Heiligen Geistes
Frucht und Gaben des Heiligen Geistes
Wolfram Kopfermann
Das Neue Testament bezeugt, dass der Heilige Geist eine Vielzahl von Wirkungen in der Gemeinde hervorbringt. Innerhalb dieser Fülle finden heute die „Gaben“ und die „Früchte“ des Geistes immer neu Beachtung.
Zunächst zur begrifflichen Klärung. Als Frucht des Geistes (Gal 5,22) bezeichnen wir das Ganze der Erneuerung des Verhaltens, die der Heilige Geist im Leben des einzelnen bewirkt. Sie ist dem Bereich der persönlichen Heiligung zugeordnet. Als Gabe des Geistes (Charisma) bezeichnen wir jede gottgegebene Befähigung, sofern sie durch den Geist Jesu Christi der Selbstverfügung entnommen und in den Dienst der Gemeinde gestellt worden ist. [1] Wir sind überzeugt, dass eine engere begriffliche Fassung dem Neuen Testament nicht gerecht wird, dass aber umgekehrt viel beachtete Charismen wie Lehre, Leitung, Prophetie, Glossolalie, Krankenheilung sich dieser Begriffsklärung gut einfügen.
I. Gemeinsamkeiten
1. Frucht und Gaben des Geistes sind gleich ursprünglich
Damit ist gemeint: Nach dem Neuen Testament baut weder die Frucht des Geistes, also die „charakterliche“ Lebenserneuerung, auf dem Vorhandensein von Charismen auf, noch können Charismen erst verliehen werden, wenn vorher Frucht des Geistes sichtbar geworden ist. Vielmehr weist alles daraufhin, dass in urchristlicher Zeit von Anfang an Frucht und Gaben des Geistes nebeneinander in der Gemeinde wuchsen. Beide Manifestationen sind nach den vorliegenden Texten den Christen bereits für den Anfang ihres Glaubenslebens zugedacht, beide sollen sich danach organisch entfalten. Sie wachsen aus einer gemeinsamen Wurzel, dem Leben im Heiligen Geist, stellen aber unterschiedliche „Äste“ dar. Noch einmal: Keines von beiden ist auf das andere zurückzuführen. So ist es auch exegetisch schlechthin falsch, wenn immer wieder behauptet wird, die höchste Gnadengabe sei nach Paulus die Liebe. Der Apostel hat die Liebe niemals als Charisma bezeichnet.
2. Frucht und Gaben des Geistes sind gleich wesentlich
Gemeint ist: Das Neue Testament bezeugt den dringlichen Willen Gottes, beiden Wirkungen des Heiligen Geistes in der Gemeinde Raum zu verschaffen. Keine wird der anderen in dieser Hinsicht nachgeordnet.
Gott legt Wert darauf, Frucht des Geistes im Leben der Gemeindeglieder zu entdecken! Die Frucht des Geistes (Gal 5,22) ist Auswirkung des Wandels im Geist (Gal 5,16), zu dem in apostolischer Autorität ermahnt wird. Wollten die Christen statt im Geist „im Fleisch“ wandeln, so dass sie die „Werke des Fleisches“ (Gal 5,19) hervorbrächten, so gälte ihnen die Gerichtsankündigung, dass die, die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden (Gal 5,21). Es geht bei der Frucht des Geistes also nicht um etwas Beliebiges, sondern um jene Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird (Hebr 12,14).
Frucht und Gaben wachsen aus einer gemeinsamen Wurzel,
dem Leben im Heiligen Geist, stellen aber unterschiedliche „Äste“ dar.
Aber auch bei den Gaben des Geistes haben wir es keineswegs mit bloßen Möglichkeiten zu tun. Das wird u.a. daran deutlich, dass Paulus in 1Kor 12,28 zu Beginn eines Charismenkataloges, der vom Aposteldienst bis zum Charisma der Hilfeleistungen reicht, erklärt, Gott habe dies alles nicht nur in Korinth, sondern in der Kirche „eingesetzt“ (dasselbe griechische Verb steht in 1Kor 12,18). Gott will den Dienst der Charismen innerhalb des Leibes Christi!
3. Frucht und Gaben des Geistes sind Geschenk und Aufgabe zugleich
Dass es sich bei beiden um göttliche Geschenke handelt, ergibt sich bereits aus dem Sprachgebrauch. Ausdrücklich stellt Paulus in Galater 5 den „Werken des Fleisches“, die wir vollbringen, die „Frucht“ des Geistes gegenüber, die also durch Gott in uns gewirkt wird. Ähnlich, wenn es um die Gaben des Geistes geht: Der Begriff “Charisma” geht auf das Grundwort charis = Gnade zurück, und Gnade meint ja Gottes Handeln für und an uns.
Dieser eindeutige Befund schließt jedoch nicht aus, dass es zugleich in unsere Verantwortung gestellt wird, nach der Frucht und den Gaben des Geistes zu trachten.
Zunächst wieder zur Frucht des Geistes. Wir hatten bereits unter I.2 gesehen, dass sie in Galater 5 als Auswirkung eines Wandels im Geist begegnet, zu dem sehr nachdrücklich aufgefordert wird. So erscheint etwa die Liebe einerseits als Frucht des Geistes, andererseits als Inhalt geistlicher Ermahnung, z .B. Römer 13 ,9. Hier ist der Sachverhalt klar.
Größere Schwierigkeiten bereitet die Frage, wie weit das Vorhandensein von Charismen ebenfalls in unsere Verantwortung gestellt ist. Häufig begegnet man der Meinung, an dieser Stelle schenke Gott, wann und wie er es wolle; es sei geradezu anmaßend, nach bestimmten Charismen zu streben. Woher wisse man denn, was Gott vorhabe? Im Extremfall gilt das Streben nach Charismen als Flucht vor der Niedrigkeit des Kreuzes Jesu Christi.
Prüfen wir diese Behauptung am Neuen Testament, so ergibt sich ein wesentlich anderer Befund. Das verdeutlicht insbesondere der 1. Korintherbrief. Im Einleitungskapitel attestiert Paulus den Korinthern, sie hätten keinen Mangel an irgendeinem Charisma. (1,7). Dieser selben Gemeinde schreibt Paulus, sie solle um die Geistesgaben eifern. Der griechische Wortstamm, der an dieser Stelle begegnet, ist uns aus dem Fremdwort „Zelot“ bekannt. Er hat hier die Bedeutung „eifrig streben, sich eifrig bemühen“ (Walter Bauer, Wörterbuch). Der bekannte Exeget Heinrich Schlier betont: „Eine Kirche ohne Charismen ist für Paulus eine arme Kirche. Man soll vielmehr um die Geistesgaben ‚eifern‘. Viermal mahnt der Apostel, selbst angesichts der durch ihren Enthusiasmus bedrohten Gemeinde in Korinth, zu diesem Eifern, 1Kor 14,39; 12,31; 14,1.12. Es sei wenigstens eine Stelle zitiert: ‚So sollt auch ihr, da ihr um den Geist eifert, darum bemüht sein, davon überzuströmen zur Erbauung der Kirche‘ (1Korinther 14,12).
Zu diesem Eifern gehört auch und gewiss nicht zuletzt das Gebet um die Geistesgaben, vgl. 1Korinther 14,13.“[2]
Noch einmal: Paulus stellt die Mitverantwortung der Gemeindeglieder für das Vorhandensein von Charismen heraus, indem er dazu auffordert, nach ihnen zu eifern. Er leitet die Korinther (1Kor 12,31) sogar an, nach bestimmten Gnadengaben mehr als nach anderen zu streben. Und er macht 1Kor 14,13 deutlich, wie dieses Streben inhaltlich zu geschehen hat: durch Gebet nämlich. Die Gegenfrage lautet: Stehen diese Aufforderungen nicht im Widerspruch zu 1Kor 12,11, wo es heißt, der Geist teile einem jeden mit, „wie er will“? Hans Conzelmann sagt zu dieser Stelle: Der Ausdruck „unterstreicht den freien Gnadencharakter der Begabung.“ Er schließt jedenfalls nach dem Zusammenhang der Kapitel 12-14 konkretes Bitten um bestimmte Gaben für den Fall nicht aus, dass die ganze Gemeinde mit ihren geistlichen Bedürfnissen dabei im Blick bleibt! Hätte Paulus seine Aussage in 1Kor 12,11 so gemeint, dass ein Christ nur beten dürfe: „Herr, du weißt besser als jeder andere, was wir zur Zeit in der Gemeinde brauchen; bitte verleih uns das!“, so wären die Konkretionen in 1Kor 12,31; 1Kor 14,1; 1Kor 14,39 widersinnig.
4. Sowohl bei der Frucht als auch bei den Gaben des Geistes gibt es ein Wachstum
Dies ist uns im Blick auf die Frucht des Geistes wahrscheinlich sofort klar. Bereits das Wort „Frucht“ spricht für wachstümliche Prozesse. Hier gibt es also ein Mehr oder Weniger. 2Korinther 9,10 drückt direkt die Zuversicht aus, Gott werde die Früchte eurer Gerechtigkeit „wachsen“ lassen; 1Thessalonicher 3,12 wird die Bitte geäußert, die Thessalonicher möchten wachsen und reich werden in der Liebe; Philipper 1,9 betet Paulus darum, dass die Liebe dieser Gemeinde immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird.
Auch die Erfahrung scheint diese Beobachtung zu bestätigen: Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte in enger Gemeinschaft mit Jesus Christus gelebt haben, besitzen oft ein liebevolles und gütiges Wesen, wie es bei Anfängern im Glauben nicht gefunden wird.
Aber auch im Praktizieren von Charismen gibt es ein Wachstum. Der paulinische Sprachgebrauch macht das vielleicht auch dadurch deutlich, dass er sowohl in Römer 12 als auch 1Korinther 12 zwischen Bezeichnungen für Personen und Aussagen über charismatische Wirkungen wechselt. Worin besteht z.B. der Unterschied zwischen jemanden, der Prophet (1Kor 12,28) ist und anderen, die prophezeien (1Kor 14,1.24)? Offenbar verdient noch nicht jeder, dem das prophetische Charisma irgendwie zuteil wurde, die Bezeichnung Prophet, sondern nur jemand, bei dem sich eine gewisse Stetigkeit und Dichte der Begabung gezeigt hat. Ähnlich scheint es sich bei der Lehrbegabung zu verhalten: Ist einer bereits ein Lehrer (1Kor 12,28), wenn er die apostolische Ermahnung praktiziert: „Lehrt … euch gegenseitig in aller Weisheit“ (Kol 3,16)? Gibt es graduelle Übergänge zwischen geistlichen Diensten und geistlichen Ämtern, so setzt dies lebensgeschichtlich zum Teil ein Wachstum im Gebrauch des jeweiligen Charismas voraus.
Auch diese Erkenntnis wird durch die Erfahrung bestätigt. Ich wähle als Beispiel die Begabungen der geistlichen Leitung, des Lehrens, der Krankenheilung, des Sprachengebetes und der Prophetie. Die drei erstgenannten Charismen sind in gewissen Ansätzen bei jedem Gläubigen vorhanden. Was Lehre und Leitung angeht, so wird das wohl niemand bestreiten, der das Leben kleiner christlichen Gruppen, etwa im Bereich der Hauskreisarbeit, kennt. Aber auch für die Gnadengabe der Krankenheilung trifft entsprechendes zu, wie bereits aus Markus 16,17f. hervorgeht, wo sehr allgemein den Glaubenden (Vers 17a) die Gabe zugesprochen wird, Kranke durch Handauflegung zu heilen. Wir wissen, dass Menschen, die Gott im Dienst der Krankenheilung in besonderer Weise gebraucht hat, oft sehr klein und im Verborgenen begannen!
Auch beim Sprachengebet kann es, wie die Erfahrung zeigt, vorkommen, dass der Heilige Geist zunächst nur wenige Silben schenkt; erst im Gebrauch der Gabe erweitert sich der „Wortschatz“. Außerdem ist der Segen dieser Gabe für den einzelnen nicht unabhängig von der Häufigkeit des Gebrauches.
Manche empfinden es als Problem, dass es auch in der Handhabung der prophetischen Gabe Wachstumsprozesse geben soll. Es scheint zunächst, als könne eine Botschaft, die den Anspruch erhebt, von Gott zu kommen, nur entweder inspiriert oder aber rein menschlichen bzw. dämonischen Ursprungs sein. Hinter dieser Meinung steht, wie mir scheint, ein unbiblisches Menschenbild: Wäre der Charismen praktizierende Christ ein sündloses Geschöpf, so dränge Gottes Reden in ungetrübter Klarheit durch. Prophetisches Reden vollzieht sich jedoch als göttliche Eingebung, die unsere nichtrationalen Persönlichkeitsschichten (etwa auch unsere Bilderwelt) „durchströmt“, ehe sie nach außen dringt. Es ist in jedem Falle von der Eigenart unserer Person mitgeprägt, wie schon ein Vergleich zwischen den prophetischen Worten des Amos mit denen des Hesekiel ergibt (ob einer Viehzüchter ist oder einer priesterlichen Tradition entstammt, hat durchaus Einfluss auf die Gestalt der Prophetie). Für unsere Frage wichtiger ist, dass geistliche Reife, die Weite des Horizontes, der Stand der persönlichen Heiligung eine Rolle im Prozess der Weissagung spielen. Es kann sich folglich nicht darum handeln, prophetische Äußerungen solange zu verbieten, wie die Gefahr sündhafter Beimischungen besteht. Wir brauchen hier wie überall geistliche Übungsfelder. (Oder soll einer erst lehren dürfen, wenn zuvor gewährleistet ist, dass Irrlehre in jeder Form ausgeschlossen werden kann? Wo brächten wir dann selbst die großen Kirchenlehrer unter?) Wesentlich ist vielmehr die offene Prüfung prophetischer Äußerungen: Nüchternheit beschreibt die biblische Mitte zwischen angstvollem Meiden und kritikloser Übernahme aller als prophetisch ausgegebenen Äußerungen!
5. Sowohl durch die Frucht als auch durch die Gaben des Geistes soll Jesus Christus verherrlicht werden
Was die Frucht des Geistes angeht, so muss unsere These wohl nicht mehr breit bewiesen werden. Frucht des Geistes gibt es nur „in Christus“; in ihr manifestiert sich das Auferstehungsleben Jesu selber. Wo Agape zutage tritt, geschieht Gottes Liebeswille „in dem Herrn“.
Es ist aber umstritten, ob das Trachten nach Charismen, die Betonung ihrer Wichtigkeit für das Leben der Gemeinde, nicht doch zu einer Schwerpunktverlagerung führt. Wird nun nicht der Akzent vom Geber auf die Gaben verlagert?
Haben wir etwas anderes zu verkündigen als Jesus Christus den Gekreuzigten (1Kor 1,23; 2,2)? Die Gefahr besagter Schwerpunktverlagerung besteht durchaus, und zwar grundsätzlich immer. Sie besteht übrigens nicht nur hinsichtlich der Charismen, wie die Kirchengeschichte zeigt. Im Falle der korinthischen Gemeinde gab es offensichtlich eine Überbewertung des Charismas der Glossolalie. Andernorts bestand oder besteht die Gefahr der Wundersucht. Es ist auch möglich, dass die Erwartung gegenwärtigen prophetischen Redens die Autorität der biblischen Offenbarung zurückdrängt. Die Frage ist nur: Haben wir mit solchen Verirrungen grundsätzlich immer zu rechnen? Mir scheint, dass ein Studium des 1. Korintherbriefes hinsichtlich unseres Problems sehr ergiebig ist.
Kurz gesagt: Es kann uns helfen, eine Gesamtschau zu gewinnen; aus falschen Polarisierungen herauszufinden; zu einer oft verlorenen Ganzheit zurück zukommen. Es stimmt, dass der Apostel im 1. Korintherbrief das “Wort vom Kreuz“ stärker akzentuiert hat als in jedem anderen uns erhaltenen Paulusbrief. Gleichzeitig hat er in einer Breite und Grundsätzlichkeit über die Auferstehung Christi und ihre axiomatische Bedeutung geschrieben (1Kor 15) wie sonst nirgends. Er hat schließlich sogar der korinthischen Gabenfülle, ja Überbewertung einer Gabe gegenüber mit Nachdruck zum Eifern um Charismen gemahnt.
Ist dies nicht alles reichlich widerspruchsvoll? Keineswegs, oder doch nur dann, wenn in theologischen „Vorstellungskreisen“ gedacht wird. Geistlich gehören diese Äußerungen für Paulus offenbar als Aspekte zusammen. Das Wort vom Kreuz (Kapitel 1 u. 2) setzt für ihn die Tatsächlichkeit der Auferstehung Jesu Christi voraus (1Kor 15,14-19); vom auferstandenen Gekreuzigten reden heißt dann auch von seinem „Leib“, der Gemeinde, reden, in welcher Gott Gnadengaben „eingesetzt“ hat (1Kor 12,18.28), nach denen man, wie nach allem, was in Christus gegeben ist, auch streben soll! Die scheinbaren Gegensätze erweisen sich sehr rasch als zusammengehörige Aussagen. Wer im Ernst behauptet, das Betonen der Charismen sei automatisch eine Entehrung Jesu Christi, zieht sich auf ein verengtes Verständnis des “Wortes vom Kreuz“ zurück, ohne das paulinische Zeugnis vom Leib Christi in seinen Konsequenzen ernst zu nehmen!
II. Unterschiede
1. Die Frucht des Geistes erwartet Gott von dem einzelnen, die Gaben des Geistes werden der Gemeinde verliehen
Es handelt sich hier um einen theologisch und praktisch sehr wichtigen Unterschied. Bei der Frucht des Geistes geht es um die persönliche Heiligung. Keiner ist an dieser Stelle vertretbar. Wie viel Raum gebe ich dem Wirken des Geistes in mir? Am Ende aller Tage, im Jüngsten Gericht, wird Gott mich nach den Werken der Liebe fragen, wie das gesamte Neue Testament bezeugt.
Es geht darum, eine Gesamtschau zu gewinnen; aus falschen Polarisierungen herauszufinden; zu einer oft verlorenen Ganzheit
zurück zu kommen.
Bei den Gaben des Geistes geht es, umgekehrt, vorn Ansatz her um die Gemeinde. Paulus macht dies deutlich, indem er von den Gnadengaben sowohl Römer 12 wie 1Korinther 12 im Rahmen seiner Aussagen über den Leib Christi spricht. Hier lautet die Frage nicht: Was brauche ich? Noch weniger: Was wünsche ich mir? Sondern: Herr, was benötigt diese deine Gemeinde? Was braucht die Kirche heute? Theologisch gesprochen: Das Thema „Gaben des Geistes“ gehört in die Ekklesiologie, in die Lehre von der Kirche, auch praktisch! Sehr viele hier und da auch heute begegnenden Probleme mit der Handhabung von Charismen lösen sich, wenn die Hinordnung auf die Gemeinde klar wird. Ein einzelner „Charismatiker“ ist so originell, aber auch so wenig sinnvoll wie ein sich über deutsche Straßen hinbewegender einzelner Arm. „Charismatische“ Grüppchen sind in dem Maße gefährdet, wie sie den Lebenszusammenhang einer örtlichen Gemeinde mit ihren Ordnungen scheuen. Pointiert gesprochen: Nicht die einzelnen Christen haben Charismen, sondern die Gemeinde besitzt sie; der einzelne Christ nur soweit, wie er am Leben der Gemeinde dienend teilhat.
2. Die Frucht des Geistes „bleibt“, die Gaben des Geistes „bleiben“ nicht
In der noch ausstehenden Vollendung des Reiches Gottes wird die Liebe (also die Frucht des Geistes) bleiben (1Kor 13,8). Sie wird bleiben, weil sie Ausdruck göttlichen Wesens ist. Selbst das Feuer des Jüngsten Gerichtes wird nicht alles verbrennen, was von Menschen getan wurde. Haben Christen auf dem Fundament, welches Jesus Christus selber ist (1Kor 3,11), mit Gold, Silber und kostbaren Steinen gebaut, so wird dieses Werk Bestand haben (1Kor 3,14).
Die Gaben des Geistes dagegen sind nur für die „Zeit der Kirche“ bestimmt. In Gottes neuer Welt werden sie nicht mehr benötigt: Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Ein Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden; wenn aber das Vollkommene kommt, vergeht alles Stückwerk (1Kor 13,8-10).
Aus der Perspektive der Ewigkeit ergibt sich also eine Abwertung der Charismen. Gewagt ist es allerdings, sie deshalb auch im Blick auf diese noch andauernde Welt für unwichtig zu halten. Wohin kämen wir, wenn wir alle Dinge, die wir in der Vollendung nicht mehr benötigen, auch heute schon für „nicht so wichtig“ erklärten?
3. Die Frucht des Geistes hängt mit der persönlichen Heiligung zusammen, das Vorkommen der Gaben keinesfalls
Der erste Teil dieser These ist bereits begründet; bedenken wir ihren zweiten Teil! Dass Gaben des Geistes auch abgesehen von der persönlichen Heiligung gegeben werden, macht z.B. die Apostelgeschichte daran deutlich, dass Charismen sogar Ungetauften zuteilwerden konnten (Apg 10,44ff.). Paulus kritisiert an den Korinthern mehrfach ihre Lieblosigkeit (vgl. 1Kor 8-9; 11,1722; 13,17), bestreitet aber ihre Charismenfülle nicht (1Kor 1,7).
Das Ergebnis ist einerseits tröstlich. Auch Christen, die unter ihrer mangelnden Heiligung leiden, können und dürfen ihre Charismen praktizieren. Gott ist ein geduldiger Gott. Die andere Seite dieser Wahrheit ist erschreckend. Sie besagt, dass Gott mir Charismen anvertrauen und diese nutzen kann, ohne mit meinem Glaubensgehorsam einverstanden zu sein. Im Extremfall kann es dazu kommen, dass ich die persönliche Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus verleugne, aber immer noch von Gott „gebraucht“ werde. Diesen Fall hat die Bergpredigt im Auge:
„Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tage (gemeint ist: des Jüngsten Gerichtes) zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten: Ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes!“ (Matthäus 7,21-23)
Hier werden christliche „Charismatiker“ angeredet. Sie besaßen die Gabe der Prophetie und betätigten sie. Sie hatten das Charisma der Dämonenaustreibung und praktizierten es, durch sie geschahen Wunder, etwa auch Wunder der Krankenheilung. Jesus Christus wird keinesfalls die charismatischen Betätigungen solcher Menschen infragestellen. Er wird ihnen allerdings bestreiten, Gemeinschaft mit ihm gehabt zu haben. Die Betätigung von Gaben des Geistes und der praktische Lebensgehorsam können demnach soweit auseinandertreten, dass Menschen für immer verloren gehen.
Dieser Gedanke ist sehr ernüchternd! Wenn Gott uns gebraucht, durch uns Segen wirkt, ist er keinesfalls ohne weiteres mit unserer Beziehung zu ihm einverstanden. Hüten wir uns vor jedem Rückschluss von dem, was Gott durch uns wirkt, auf sein Ja zu unserer Lebensführung!
Für Frucht und Gaben des Geistes gilt sinngemäß, was Paulus Philipper 4,19-20 schrieb: „… in Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlich keit schenken. Unserem Gott und Vater sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.“
Anmerkungen:
[1] Zur Begründung dieser Definition vergleiche meine Schrift „Charismatische Gemeinde-Erneuerung – eine Zwischenbilanz“, Hochheim 1981
[2] Heinrich Schlier: Herkunft, Ankunft und Wirkungen des Heiligen Geistes im Neuen Testament, in: Claus Heitmann/Heribert Mühlen (Hrsg.): Erfahrung und Theologie des Heiligen Geistes, Hamburg/München 1974, S.129
Der Artikel erschien erstmals in: Rundbrief der Charismatischen Gemeinde-Erneuerung in der evangelischen Kirche, 12, Juni 1982, S. 3-8. Überarbeitung 2016
Das Wirken des Heiligen Geistes: Wort und Kraft
Wolfram Kopfermann
Frucht und Gaben des Heiligen Geistes
Wolfram Kopfermann
Aktuelles
Anskar-Konferenz 2024 zum Nachhören
Im Mai / Juni fand unsere Anskar-Konferenz 2024 in Hamburg mit Christophe Domes statt zum Thema "WINDSTÄRKE - zwischen Sturm und sanfter Brise". Alle Vorträge gibt es auf dem Youtube-Kanal der Anskar-Kirche Deutschland und als Podcast